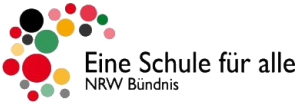Zwei Jahre lang hat die Enquetekommission im Auftrag des Landtags von Nordrhein-Westfalen zum Thema „Chancengleichheit in der Bildung“ gearbeitet. Aber demokratische und menschenrechtliche Ansprüche an Bildung löst die Kommission mit ihren Handlungsempfehlungen nicht ein.
Zwei Jahre lang hat die Enquetekommission im Auftrag des Landtags von Nordrhein-Westfalen zum Thema „Chancengleichheit in der Bildung“ gearbeitet. Aber demokratische und menschenrechtliche Ansprüche an Bildung löst die Kommission mit ihren Handlungsempfehlungen nicht ein.
Bildungsungleichheit ist die Konstante im Bildungssystem, auch wenn Bildungsgerechtigkeit bei jeder Gelegenheit als bildungspolitisches Ziel beschworen wird. Die strukturelle Weichenstellung von dem gegliederten zu einem demokratischen Schulsystem ohne äußere Gliederung und Selektion, wie es schon der Deutsche Bildungsrat in den 1970er Jahren angedacht hatte, ist bis heute nicht in Sicht. Auch die Kommission gibt in ihrem Abschlussbericht keine Empfehlung für diese längst überfällige grundlegende Strukturreform ab.
In seiner historischen Einordnung der ungelösten Ungleichheitsproblematik in der Bildung ignoriert der Kommissionsbericht, dass mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) der demokratische Gleichheitsbegriff menschenrechtlich erweitert worden ist. Inklusive (Chancen-) Gleichheit als Menschenrecht fordert von der Politik, alle segregierenden und diskriminierenden Strukturen zu identifizieren und zu transformieren, damit das Recht auf inklusive Bildung, das allen Lernenden gleichermaßen zusteht, realisiert wird.
Der blinde Fleck
Der inklusive Gleichheitsanspruch umfasst nach Theresia Degener, Rechtsprofessorin und ehemalige Vorsitzende des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, vier Dimensionen. Dazu zählen: der faire Ausgleich sozioökonomischer Benachteiligungen, die Verteidigung der Würde des Menschen, die Bestätigung der sozialen Natur des Menschen durch Inklusion und Partizipation und die Akzeptanz von Unterschieden und Vielfalt.
Der inklusive Gleichheitsanspruch an Bildung ist der blinde Fleck in der Wahrnehmung der Kommission. Damit kann sich die Kommission vor der kritischen Auseinandersetzung mit dem bestehenden Schulsystem, das von Selektion, Segregation und Exklusion geprägt ist, und dem Vergleich mit dem inklusiven Schulsystem als menschenrechtliches Gegenmodell drücken.
Die schonungslose Bestandsaufnahme des Förderschulsystems mit seiner empirisch nachgewiesenen sozialen Ausgrenzung und seinen stigmatisierenden Effekten, die über die Schulzeit hinaus wirksam bleiben, bleibt genauso ausgespart wie die Analyse sozialer Ausschlüsse im allgemeinen Schulsystem mit ihren identitätsbeschädigenden und negativen gesellschaftlichen Folgen.
Die Paradoxien von Inklusion im bestehenden gegliederten System werden totgeschwiegen. Die Kommission nimmt hin, dass das privilegierte Gymnasium auch das Privileg genießt, sich der Aufgabe der sozialen Inklusion zu entziehen. Dagegen akzeptiert sie als selbstverständlich, dass die sozial marginalisierte Hauptschule, die kaum noch freiwillig angewählt wird und ihren Schüler:innen den Erwerb des Hauptschulabschlusses nicht einmal mehr garantieren kann, diese Aufgabe übernimmt.
Beliebige Handlungsempfehlungen
Es ist nicht verwunderlich, dass dieser Mangel an Bewusstsein für das Recht auf inklusive Bildung und Gleichheit sich in beliebigen Handlungsempfehlungen zu Inklusion und groben Verletzungen der UN-BRK niederschlagen.
Die massive öffentliche Kritik an der mangelhaften Umsetzung schulischer Inklusion wegen unzureichender Rahmenbedingungen mündet nicht in die konsequente Forderung nach einem systematischen Rückbau der Förderschulen und dem Transfer der sonderpädagogischen Ressourcen in die allgemeinen Schulen, wie dies der zuständige UN- Fachausschuss in seiner Auslegung der UN-BRK ausdrücklich fordert. Stattdessen empfiehlt die Kommission, „das gemeinsame Lernen und die Förderschulen als gleichberechtigte Angebote sonderpädagogischer Förderung weiterzuentwickeln und bedarfsgerecht auszustatten“.
Abgesehen davon, dass diese Forderung wohlfeil ist, weil sie wegen der prekären Ressourcensituation nicht umgesetzt werden kann, legitimiert sie den Bestand der Förderschulen und deren Ausbau, der in NRW derzeit politisch ungebremst und politisch unhinterfragt stattfindet, ebenso wie das Elternwahlrecht.
Trotz Aufklärung des zuständigen UN-Fachausschusses in seinem Kommentar zum Recht auf inklusive Bildung und seiner Kritik am Fortbestand der Förderschulen im Rahmen der Staatenprüfung Deutschlands missachtet die Kommission in ihren Empfehlungen, dass das Recht des Kindes auf inklusive Bildung der menschenrechtliche Kern ist, der umgesetzt werden muss, und nicht das Elternwahlrecht.
Unter Kontrolle evidenzbasierter (sonder-)pädagogischer Diagnostik
Die Kommission folgt dem NRW-Gutachten zu den sonderpädagogischen Feststellungsverfahren. Demnach soll durch den frühzeitigen und regelmäßigen Einsatz von standardisierten und normorientierten Lernstands- und Lernverlaufsmessungen mit wissenschaftlich bewährter, evidenzbasierter Diagnostik und adaptiven Förderprogrammen die Zahl der sonderpädagogischen Feststellungsverfahren verringert, die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs evidenzbasiert ermittelt und die Inklusion der sonderpädagogisch Förderbedürftigen ermöglicht werden.
Die Kommission spricht sich auch für die Einführung der datengestützten Unterrichts- und Schulentwicklung aus. Damit stimmt sie zu, dass die evidenzbasierte (sonder-)pädagogische Diagnostik die individuellen Lernverläufe aller Schüler:innen vermisst und als Daten abspeichert, damit mit geeigneten Maßnahmen Mindeststandards gesichert und Leistungen optimiert werden. Perspektivisch sollen nach Planungen von Bund und Ländern Individualdaten über Bildungsverläufe aller Schüler:innen wie beispielsweise Übergänge und Abschlüsse mit Hilfe einer Schüler-ID anonymisiert in einem bundesweiten Bildungsverlaufsregister erfasst und zur gezielten bildungspolitiscihen Steuerung bereitgestellt werden.
Keine inklusive Bildung
Die Kommission unterstützt die bildungspolitische Entwicklung zu einem Schüler:innen-Monitoring, das mit der evidenzbasierten Diagnostik Output und Ertrag von Leistung in das Zentrum stellt. Sie ist bildungspolitisches Mittel zur ständigen Kontrolle, Überwachung und Steuerung des Lernens mit standardisierten und normierten Tests, die sich an vorgegebenen Bildungsstandards und Normalitätserwartungen orientieren.
Kinder und Jugendliche werden in ihrem Recht auf eigenwirksames und inklusives Lernen als Subjekt ihres Lernens und ihrer Lernentwicklung noch erheblicher behindert und eingeschränkt, als sie es derzeit unter dem Druck der Leistungsselektion erleben. Damit werden ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden aufs Spiel gesetzt. Mit inklusiver Bildung hat diese Politik absolut nichts zu tun.
Dr. Brigitte Schumann 11/2025