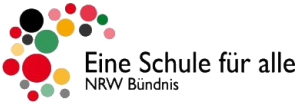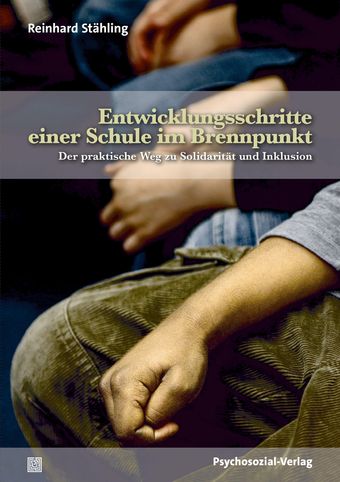
von Roland Grüttner
Dr. Reinhard Stähling beschreibt in seinem neuen Buch die Entwicklung der Schule Berg Fidel Geist in Münster aus Sicht der Schulleitung, in der er dreißig Jahre lang Verantwortung getragen hat. Der Bericht umfasst fünf Jahrzehnte einer Grundschule, die durch einen schwierigen sozialen Kontext stark herausgefordert war, bis hin zu ihrer gegenwärtigen Gestalt als inklusive PRIMUS-Schule mit zehn Jahrgängen.
Das grundsätzliche Konzept dieses Buches gibt eine klare Wegweisung: Im ersten Teil beschreibt Reinhard Stähling anhand seines Tagebuches die spannungsreiche Entwicklung der Schule im Stadtteil Berg Fidel chronologisch. Im zweiten Teil beleuchtet er diese Entwicklung auf dem Hintergrund verschiedener theoretischer Ansätze unter Bezug auf eine reichhaltige einschlägige Literatur. Dieses kluge Buch ist wertvoll vor allem für die Entwicklung von so genannten „Brennpunktschulen“; es enthält aber unabhängig davon viele gute Ideen für Langformschulen, die ja alle mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
Teil 1: Ein Tagebuch
Reinhard Stähling hat Tagebuch geführt. Es setzt 1992 ein, als er sich an die Grundschule Berg Fidel versetzen ließ, damals geleitet von Dr. Manfred Pollert, einem offensichtlich recht unabhängigen Geist. Das Ziel der Reise hat sich erst im Laufe der Entwicklung herauskristallisiert:
„Das Ziel all dieser Anstrengungen war es, dass die Kinder mehr Zeit zum effektiven Lernen bekommen sollten.“
Dieses Ziel hat immer stärker den Weg bestimmt und die Hindernisse erkennen lassen, die aus dem Weg zu räumen waren (und noch sind). Der Weg umfasste folgende Stationen:
• Vom normal gefächerten Stundenplan zur freien Arbeit jeden Vormittag;
• Vom Beschulen gesunder Kinder zur Inklusion aller Kinder im Sprengel, auch von Kriegsflüchtlingen, insbesondere Rom*nja;
• Vom Halbtags- zum Ganztagsunterricht;
• Von Jahrgangsklassen zur Altersmischung;
• Von Sondergruppen hin zu Verteilung des sonderpädagogischen Budgets auf alle Klassen;
• Von wechselnden Zuständigkeiten zur Einrichtung von festen Klassenteams;
• Von gelegentlichen Befragungen der Kinder zur Bildung von Klassenräten;
• Von einer reinen Grundschule zu einer Langformschule bis Klasse 10.
Was es dabei nicht gab: einen Masterplan der Schulentwicklung, der zu Beginn genial konzipiert und dann abgearbeitet wurde. Was es stattdessen gab: Diskussionen – Versuche – Rückschläge – Hospitationen – weitere Versuche – weitere Diskussionen – Erfahrungen – und schließlich Vereinbarungen. Man könnte diese Art der Schulentwicklung mit einem Modewort „agil“ nennen. Was sie aber vor allem war und ist: mühsam, beharrlich und letztlich erfolgreich. Warum? Weil sie auf das richtige Ziel gerichtet war und immer noch ist: mehr Zeit zum effektiven Lernen.
Teil 2: Aussondernde Strukturen außer Kraft setzen
Folgende Strukturen wurden angedacht, diskutiert, ausprobiert, nachjustiert und schließlich etabliert:
• Freie Arbeit, weil so jedem Kind sein eigenes Lerntempo zugestanden wurde;
• Keine Noten bis einschließlich 8. Klasse, weil sie vom Lernen ablenken;
• Gebundener Ganztag, um die Möglichkeiten der Freien Arbeit zu verlängern;
• Ein eigenes Team für jede Klasse zur koordinierten Unterstützung jedes Kindes;
• Altersmischung, damit sich die Kinder gegenseitig helfen und die Lehrer sich Zeit für Einzelförderung „ermogeln“ konnten;
• Offenheit für wirklich jedes Kind im Stadtteil, gleich welcher Herkunft, natürlich auch solche mit einer Behinderung;
• Wöchentlicher Klassenrat, um lernhinderliche Spannungen zu bearbeiten und zu vermeiden;
• Verlängerung der Lernzeit an der eigenen Schule bis zum Abschluss nach der 10. Klasse.
Reinhard Stähling versucht, diese Veränderungen im Spiegel von Bertold Brechts Reflexionen zu betrachten: Im Umgang mit hinderlichen Strukturen brauche es Klugheit, diese zu erkennen; den Mut, sie verändern zu wollen; die Kunst, sie umzubauen; das Urteilsvermögen, die Mitstreiter zu erkennen und schließlich auch List, um die Erkenntnisse weiter zu verbreiten. Das liest sich leichter, als es in Realität war; hier darf man keinen Illusionen verfallen. Man musste aus Gründen der Arbeitsbelastung - zeitweise und länger als gewollt - auch alte ungünstige Strukturen am Leben lassen, immer wieder sicheren Boden verlassen, um Neues auch unter Widerspruch auszuprobieren, an anderen Schulen hospitieren und der Erwartung entgegentreten, man würde immer gleich zu perfekten Lösungen kommen. Stähling findet aus der Beschreibung heraus immer wieder bemerkenswerte Zuspitzungen:
„Vollkommen konnte nichts an einem dynamischen System sein; allenfalls konnte man davon träumen.“ (S. 231)
Teil 3: In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt – das Beispiel der Rom*nja
(Der „Rom“ ist ein männliches Mitglied dieser Volksgruppe, „Romnja“ ein weibliches, dazwischen der Genderstern.)
Die Schule Berg Fidel wird von Kindern aus ehemaligen Rom*njafamilien besucht. Stähling beschreibt das Schicksal dieser Menschengruppe – die zu früheren Zeiten als „Zigeuner“ bezeichnet und häufig diskriminiert wurden – aus zwei Wurzeln heraus: die eine ist die Entwicklung unseres aussondernden Schulsystems von der Hilfsschule bis zu den immer noch vorhandenen Widerständen gegen Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Dazu muss man wissen, dass die Schule Berg Fidel ab 1997 zu den Grundschulen in Münster zählte, die Kinder mit Behinderung integrierte. Die Bilanz:
„Unser eigenes Konzept ‚Sonderpädagogische Förderung‘ hat seit 1997 zehn bis 20 Jahre gebraucht, um dem aussondernden Schulsystem trotzen zu können. Ein steiniger Weg.“
Die andere Wurzel wurde gebildet im Kampf gegen dauerhafte Bemühungen bürokratischer Akteure, die Rom*nja-Familien und -Kinder außen vor zu halten. Ende der 1990er Jahre waren viele nach Münster gekommen, als Flüchtlinge vor dem Krieg im Kosovo. Einige dieser Flüchtlingsfamilien wurden in der Nähe der Grundschule Berg Fidel in einer Obdachlosensiedlung untergebracht – 250 Personen auf engem Raum. Die Kinder, die teils schwer traumatisiert waren, unterlagen nicht der Schulpflicht, aber die Eltern wollten, dass sie eine Schule besuchten. Die Integration dieser Kinder war sprachlich und sozial schwierig, aber sie gelang.
Teil 4: Brennpunktschule und die Pädagogik der Unterdrückten
Reinhard Stähling legt diesem Kapitel die Arbeiten des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire zugrunde. Der Ausgangspunkt:
„Freire kritisierte eine anti-dialogische Praxis, die Menschen zu Objekten machte.“
Im Anschluss an Freire – und in Übereinstimmung mit Hattie – sieht Stähling die Gefahr des Verharrens im banking model of education, das die Lernenden lediglich als passiv Konsumierende, als „Behälter“ (sic, bei Hattie heißt es bucket!) sieht, eben als Objekte, in denen die Lehrenden ihr Wissen wie Spareinlagen deponieren. Das Kollegium der Berg-Fidel-Schule versucht, die Kinder aus diesem Objektstatus herauszuheben, sie als Subjekte und Gegenüber zu verstehen und leitet daraus unter anderem das Recht jedes Kindes auf ein gesundes Mittagessen ab. Da stehe die Schule in der Pflicht, auch wenn die Antragsstellung im Rahmen des Teilhabeprogrammes ebenso umständlich und langwierig sein kann wie die Scham der betroffenen Familien groß. Die Schule sieht sich selbst als eine Caring Community. An diesem Punkt gilt, was auch in einem Exkurs zur Reformpädagogik deutlich wird: Der Ausgangspunkt für jedwede Leistungsverbesserung und Chancenermöglichung kann nur die Einzelschule sein. Reinhard Stähling sieht den Kurs seiner Schule auch durch die Empfehlungen von PISA (2023) bestätigt, unter anderem:
• Die Schüler:innen darauf vorbereiten, eigenständig zu lernen;
• Partnerschaften zwischen Schulen und Familien stärken und die Eltern in den Lernprozess der Schüler:innen einbinden;
• Das Alter anheben, in dem die Aufteilung auf verschiedene Bildungsgänge erfolgt;
• Schüler:innen mit Schwierigkeiten zusätzliche Unterstützung bieten, anstatt sie Klassen wiederholen zu lassen;
• Die Schule als zentralen Ort der sozialen Interaktion etablieren.
Das Ergebnis kann sein, dass solche Brennpunktschulen „erwartungswidrig gute“ Lernzuwächse aufweisen können, wie es die Begleitforschung bestätigte.
Teil 5: Aktuelle Probleme und Lösungen
Auch eine Schule, die schon viele gute Antworten gefunden hat, muss mit Problemen kämpfen, für die es noch keine Lösungen gibt. Reinhard Stähling nimmt zwei davon genauer unter die Lupe:
„Wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen um, die die Schule verweigern?
Wie bekommen wir mehr sonderpädagogische Personalstellen, um unsere Arbeit im Brunnpunkt zu unterstützen?“
Die Antwort auf die erste Frage sieht Stähling im Herausarbeiten der Ursachen, die im Sozialen ebenso liegen können, wie im Unterricht. Dabei ist er nicht zimperlich:
„Wenn Lehrpersonen Schüler*innensorgen ignorieren, muss dies als eine Form von psychischer Gewalt und als ‚Kunstfehler‘ betrachtet werden.“
Bei allem Verständnis für die Verweigerer wird konsequent vorgegangen: Die Lehrer:innen machen regelmäßig Hausbesuche, holen Schüler:innen auch mal von zuhause ab und verdeutlichen dabei die Konsequenzen – Ordnungsstrafen, Jugendgericht –, die erfolgen, wenn jemand der Schulpflicht nicht genügt. In der Beantwortung der zweiten Frage nach der Verteilung der sonderpädagogischen Personalstellen spart Reinhard Stähling nicht mit Kritik an der Zuweisungspraxis der verantwortlichen staatlichen Stellen. Sie stellt betroffene Schulen vor das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma: Um Gelder und Stellen beantragen zu können, benötigt man eine Diagnose. Aber die könnte sich durch Etikettierung negativ auf das Selbstbewusstsein der Kinder, auf ihren Stand innerhalb der Gruppe und auf ihr Lernen auswirken. Deshalb werden die Namen der betroffenen Kinder nicht bekannt gemacht. Es fragt auch niemand nach den Namen, weil die Schule ohnehin jedes Kind im Sprengel aufnimmt. Und in der Aufnahmephase für die neu einzuschulenden Schüler:innen überlegen alle sieben Klassenteams gemeinsam, welches Kind am besten in welche Gruppe passt und verteilen die sonderpädagogischen Ressourcen gleichmäßig untereinander.
Fazit
Auch wenn man, wie ich, nicht an einer Brennpunktschule arbeitet, kann man diesem Buch sehr Vieles abgewinnen. Beeindruckend finde ich die Darstellung des langen Weges mit immer neuen Problemlagen und die offene Beschreibung auch der fehlerhaften Versuche, darauf pädagogische Antworten zu finden. Ich habe neu gelernt, den Wert der schulischen Impulsgeber zu schätzen, die auch immer wieder lästig scheinende Diskussionen auslösen, und den Wert dieser Diskussionen, die nach Auseinandersetzungen und Ausprobieren immer wieder zu erstaunlichen schulinternen Lösungen führen, die nicht unbedingt vorauszusehen waren. Neben dieser Entwicklungsskizze, die man als Modell auch für andere Brennpunktschulen sehen kann, bietet das Buch eine Fülle von pädagogischen und gesellschaftstheoretischen Überlegungen, die dazu anregen, auch die Hintergründe genauer zu beleuchten, vor denen wir Unterricht und Schule betreiben.
Links und Materialien
Dr. Reinhard Stähling liest aus seinem Buch „Entwicklungsschritte einer Schule im Brennpunkt“
Das umstrittene 17. Schulrechtsänderungsgesetz, in dem der Bestand der PRIMUS-Schulen garantiert wird. Es enthält auch die Genehmigung für Realschulen einen eigenen Hauptschulzweig anzubieten. Diese Regelung führt zu heftigen Auseinandersetzungen.
________
Stähling, Reinhard (2025). Entwicklungsschritte einer Schule im Brennpunkt. Der praktische Weg zu Solidarität und Inklusion, Gießen 2025, Psychosozial Verlag