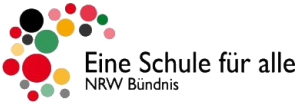Wie viele wissenschaftliche Erkenntnisse und wie viele Beweise braucht es noch, damit die Bildungspolitik die strukturelle Macht und Willkür sonderpädagogischer Diagnostik erkennt und Konsequenzen zieht? Stattdessen will sie den Einfluss der sonderpädagogischen Diagnostik ausweiten.
Wie viele wissenschaftliche Erkenntnisse und wie viele Beweise braucht es noch, damit die Bildungspolitik die strukturelle Macht und Willkür sonderpädagogischer Diagnostik erkennt und Konsequenzen zieht? Stattdessen will sie den Einfluss der sonderpädagogischen Diagnostik ausweiten.
Im Fall von Nenad M. gelang es mit Unterstützung des Vereins mittendrin e.V., das Land NRW 2018 in einem spektakulären Prozess auf Schadensersatz zu verklagen. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Schüler zu Unrecht als geistig behindert diagnostiziert und in einer Kölner Förderschule für Geistige Entwicklung jahrelang um sein Recht auf Bildung betrogen worden war. Die Forderung nach einer systematischen Untersuchung durch eine unabhängige Untersuchungskommission, die den Hinweisen auf weitere Fälle und den strukturellen Ursachen für unrechtmäßige Diagnosen nachgehen sollte, wurde vom Schulministerium damals jedoch abgelehnt. Der „Einzelfall“ reichte nur für eine hausinterne Überprüfung.
Das aktuelle Beispiel willkürlicher Diagnostik
Der Fall einer alleinerziehenden Mutter und ihrer Tochter in Rheinland-Pfalz, über den auf Bildungsklick ausführlich berichtet wurde, beweist aktuell, wie willkürlich und wirkmächtig sonderpädagogische Gutachten mit ihrer Diagnostik sind.
Während der gesamten Schulzeit ihrer Tochter hatte sich die Mutter konsequent geweigert, sonderpädagogische Gutachten anzuerkennen, die ihrer Tochter die Diagnose „Lernbehinderung“ bescheinigten. Zu Recht! Die als lernbehindert diagnostizierte Tochter wird am Ende dieses Schuljahres den Realschulabschuss bekommen. Aber Mutter und Tochter haben im Kampf gegen das Unrecht der Gutachten einen hohen Preis zahlen müssen. Das rheinland-pfälzische Schulministerium hat bis heute nicht die Unrechtmäßigkeit der Vorgänge eingestanden.
Die Macht der Sonderpädagogik
Auch wissenschaftliche Kritik an der sonderpädagogischen Diagnostik wegen ihrer Scheinobjektivität, fehlenden Validität und ihrer Funktion für die Zwangsauslese in die Sonderschule hat die Bildungspolitik und die öffentliche Meinung in ihrem Glauben an die Sonderpädagogik und an das System der sonderpädagogischen Diagnostik und Förderung in der Vergangenheit nicht erschüttern können.
Bildungspolitik und Sonderpädagogik haben nach 1945 anstelle einer gründlichen Aufarbeitung der Beteiligung der Sonderschule und der Sonderpädagogik an Zwangssterilisation und Euthanasie im Nationalsozialismus den Ausbau des Sonderschulsystems als „Wiedergutmachung“ der Verbrechen an behinderten Kindern kommuniziert und den Mythos vom „Schonraum Sonderschule“ verbreitet. Diese beiden Narrative haben der Sonderpädagogik zu ihrem hohen Ansehen in Deutschland verholfen, wie Prof. Dagmar Hänsel in ihren zahlreichen historischen Untersuchungen (2006, 2018, 2024) herausgestellt hat.
Ob die aktuellen Erkenntnisse über den systematischen Missbrauch sonderpädagogischer Diagnostik in Tausenden von sonderpädagogischen Feststellungsverfahren, die das Gutachten im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung 2024 festgestellt hat, die positive Einstellung der Bildungspolitik und der öffentlichen Meinung zum System sonderpädagogischer Diagnostik und Förderung verändern, darf bezweifelt werden. Im politischen und gesellschaftlichen Meinungsbild steht die Förderschule gegenüber der Inklusion so hoch im Kurs wie nie zuvor.
Wissenschaftliche Kritik an der sonderpädagogischen Diagnostik
Der Förderschwerpunkt Lernen, dem die meisten Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zugeordnet werden, steht seit langem im Zentrum wissenschaftlicher Kritik an der sonderpädagogischen Diagnostik. Er wurde früher offiziell als „Lernbehinderung“ bezeichnet und steht strukturell in der Kontinuität der geschichtsbelasteten sonderpädagogischen Kategorie der „Hilfsschulbedürftigkeit“.
Der Förderschwerpunkt gilt als unhaltbare Konstruktion ohne valide wissenschaftliche Kriterien (Begemann 1970; Preuss-Lausitz 1976, Sander 1982; Eberwein 1996, Wocken 2000, Hänsel 2003, Pfahl 2011, van Essen 2013, Blanck 2022). Eine eindeutige Unterscheidung zwischen pädagogischem und sonderpädagogischem Förderbedarf ist daher nicht möglich und rein willkürlich. Die Grenzziehung zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wird ebenfalls als problematisch wahrgenommen.
Der Gebrauch standardisierter Intelligenztests, der sich aus dem Mangel an soliden Kriterien zur Bestimmung des sonderpädagogischen Förderbedarfs erklärt, wird ebenfalls kritisiert. Mit der IQ-Diagnostik wird das Schulversagen als Intelligenzschwäche zu begründen versucht und dabei der erhebliche Einfluss der sozialen Herkunft der betroffenen Kinder ausgeblendet, die in der Regel mit sozioökonomischer und soziokultureller Benachteiligung verknüpft ist.
Die IQ-Diagnostik ignoriert, dass für Kinder der Unterschicht die Anforderungen der Mittelschicht-Schule einen krassen „Milieubruch“ zu ihrem Habitus darstellen und daher Abweichungen von den schulischen Erwartungen quasi vorprogrammiert sind. Folglich werden Probleme fehlender Passung dem Kind einseitig als Problem zugeschrieben und in sonderpädagogischen Förderbedarf uminterpretiert.
Verzicht auf Förderschule und Feststellungsdiagnostik bei LES
Als Konsequenz aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen haben die Professoren Klaus Klemm und Ulf Preuss-Lausitz 2011 in ihrem Gutachten für die damalige rot-grüne Landesregierung in NRW den Verzicht auf die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und den affinen Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache (LES) vorgeschlagen. Sie begründeten den Vorschlag damit, dass die Förderschulen LES die Schulen der Armen und sozial Randständigen sind, für die es weder eine pädagogische noch eine soziale Begründung geben darf.
Die Förderschulen sollten jahrgangsweise auslaufen. Die freiwerdenden sonderpädagogischen Stellen sollten in den allgemeinen Schulen zur Förderung verankert werden. Kinder mit dem bisherigen Förderschwerpunkt LES sollten in den allgemeinen Schulen aufgenommen werden und dort verbleiben. An die Stelle einer an individuelle Feststellungsverfahren gebundenen Mittelzuweisung sollte eine pauschale Zuweisung unter Berücksichtigung von Sozialindikatoren bei der Verteilung auf die einzelnen Schulen treten und mit einer Rechenschaftspflicht über die schulinterne Förderung versehen werden.
Unnötig zu erwähnen, dass die NRW-Regierung dem Vorschlag nicht folgte und auch kein anderes Bundesland, mit Ausnahme von Bremen, die sonderpädagogischen Doppelstrukturen in den Förderschwerpunkten LES konsequent abgeschafft hat.
Verzicht auf unbrauchbare sonderpädagogische Kategorisierungen
Die Wissenschaftler:innen Schuck, Rauer und Prinz haben 2018 in ihrer Studie im Auftrag der Behörde für Schule und Berufsbildung die Forderung nach Verzicht auf sonderpädagogische Kategorisierungen untermauert. Sie stellen heraus, „dass die schulorganisatorisch verwendeten Kategorien sonderpädagogischer Förderungen kaum eine brauchbare prognostische Qualität und Differenzierungskraft für die Entwicklung der Schüler:innen haben. Wird zudem berücksichtigt, dass sonderpädagogisch geförderte Kinder nahezu durchgängig ihre emotional-sozialen Schulerfahrungen schlechter einschätzen als die nicht sonderpädagogisch geförderten, sind der Nutzen und die Folgen solcher Kategorisierungen neu abzuwägen“.
Mit der Annahme, dass mit der Zuweisung der sonderpädagogischen Förderung keine Realität abgebildet, sondern eine sonderpädagogische Realität geschaffen wird, stellen Schuck et al. auch die sonderpädagogische Förderung in Frage. Es sei darüber hinaus höchst fraglich, „ob mit dem kategorialen Begriff der sonderpädagogischen Förderung überhaupt eine hinreichend eindeutige und sachgerechte Beschreibung individueller Fördernotwendigkeiten und -bedürfnisse in unterschiedlichen Leistungs- und Persönlichkeitsbereichen möglich sein kann“.
Die Forscher:innen fordern dazu auf, inklusive Schulentwicklung aus der Verankerung in der traditionellen Sonderpädagogik zu lösen. Ihre Empfehlungen an die Behörde und die Politik sind bis heute nicht einmal diskutiert worden.
„Etikettierungsschwemme“ und „Pseudo-Inklusion“
Prof. Hans Wocken (2017) hat mit seinen wissenschaftlichen Befunden zur „Etikettierungsschwemme“ am Beispiel von Bayern lange vor der Veröffentlichung des Gutachtens zum Wissenschaftlichen Prüfauftrag in NRW die Kritik an der sonderpädagogischen Diagnostik erheblich verschärft.
Er hat vorgerechnet, dass sich auch bundesweit und in den meisten Bundesländern der Anstieg der Inklusionsquoten nicht, wie es nach der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sein sollte, mit dem entsprechenden Abbau der Segregationsquoten in den Förderschulen erklärt. Verantwortlich für ihren Anstieg ist die vermehrte Etikettierung und Kategorisierung von schulleistungsschwachen Grundschulkindern als „sonderpädagogisch förderbedürftig“ mittels willkürlicher sonderpädagogischer Diagnostik.
In seiner Kritik macht sich die Sonderpädagogik mit der „Etikettierungsschwemme“ zum Produzenten eines willkürlich erhobenen sonderpädagogischen Förderbedarfs und zum willfährigen Ressourcenbeschaffer der allgemeinen Schulen. Sie betreibt Pseudo -Inklusion, weil sie Kinder, die schon in den Grundschulen sind, zu „Inklusionskindern“ macht, während die Förderschulkinder „draußen“ bleiben.
Es ist nicht bekannt, dass die Bildungspolitik auf Wockens Veröffentlichungen über den skandalösen Missbrauch der sonderpädagogischen Diagnostik reagiert hat.
Die Strategie der empirischen Sonderpädagogik
Die empirische Sonderpädagogik hat inzwischen die Notwendigkeit erkannt, mit evidenzbasierten Programmen der Diagnostik, Prävention und Förderung gegenüber der Bildungspolitik in die Offensive zu gehen, um ihr bildungspolitisches Terrain und ihren gesellschaftlichen Einfluss zu erhalten und der Kritik und den Zweifeln an ihrer Diagnostik zu begegnen.
Ihre Vorstellungen finden sich in dem aktuellen Gutachten wieder, das die NRW-Landesregierung als Prüfauftrag an ein Wissenschaftskonsortium vergeben hat.
Der festgestellten Ressourcenbeschaffung mittels missbräuchlicher sonderpädagogischer Feststellungsverfahren soll mit der Einführung einer präventiven Ressourcenzuweisung begegnet werden. Damit sollen Schulen in die Lage versetzt und verpflichtet werden, mit evidenzbasierten Methoden und Programmen Unterricht, Diagnostik und präventive Förderung auszugestalten, Schulversagen zu vermeiden und den Erwerb basaler Kompetenzen für alle zu sichern.
Risikoschüler:innen sollen durch regelmäßige Screenings aller Schüler:innen rechtzeitig erfasst und einer präventiven Förderung zugeführt werden. Lernverlaufsdiagnostik soll möglichst engmaschig die Wirkung evidenzbasierter Diagnose-Förderprogramme erfassen, überprüfen und dokumentieren. Wenn die evidenzbasierte Förderung nachweislich nicht erfolgreich ist, ist eine gezielte sonderpädagogische Einzelförderung vorzunehmen, die sowohl in der allgemeinen Schule als auch in der Förderschule stattfinden kann. Auch für Schüler:innen ohne präventive Förderung sollen die Lernverläufe überwacht und dokumentiert werden.
Ausweitung der Macht sonderpädagogischer Diagnostik
Die empirische Sonderpädagogik schreibt mit ihren wissenschaftlichen Empfehlungen alte sonderpädagogische Denkweisen und Strukturen im modernen Gewand der evidenzbasierten empirischen Forschung fort und wendet sie auf alle Kinder an. Sie nimmt in dieser Konzeption, die der präventiven Förderung dienen soll, eine herausgehobene Stellung ein.
Ihre Vorstellungen machen Kinder und Jugendliche zu Objekten des evidenzbasierten messbaren Lernens. Sie werden in ihrem Lernen überwacht, gesteuert und angepasst an die Erfüllung vorgegebener Standards. Diese Vorstellungen sind das Gegenteil von einem humanistisch, demokratisch und menschenrechtlich geprägten Bildungsbegriff.
Zusammen mit der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) hat sie die Entwicklung eines Schüler:innen-Monitorings im Blick, das die Lern- und Bildungsverläufe aller Schüler:innen abbilden soll.
Die Idee ist keine ferne Zukunftsidee. Sie hat sogar schon Eingang gefunden in den Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung. Diese will unter Achtung der jeweiligen Zuständigkeiten „gemeinsam mit den Ländern für die nächste Dekade relevante und messbare Bildungsziele vereinbaren und eine datengestützte Schulentwicklung und das Bildungsverlaufsregister schaffen“.
Und das ist noch nicht alles. Sie will auch die „Einführung einer zwischen den Ländern kompatiblen, datenschutzkonformen Schüler-ID unterstützen“ und damit die Verknüpfung mit der Bürger-ID ermöglichen. Das sollte nicht nur die Datenschutzbeauftragten aller Bundesländer auf den Plan rufen!
Dr. Brigitte Schumann 06/2025