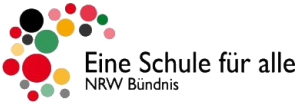Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat im März die Mehrheitsanteile an der RuhrFutur gGmbH übernommen. Der Einstieg in das Bildungsunternehmen markiert einen bemerkenswerten Positionswandel in der Verbandsgeschichte.
Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat im März die Mehrheitsanteile an der RuhrFutur gGmbH übernommen. Der Einstieg in das Bildungsunternehmen markiert einen bemerkenswerten Positionswandel in der Verbandsgeschichte.
RuhrFutur wurde 2013 von der Stiftung Mercator als Initiative für mehr Bildungsgerechtigkeit im Ruhrgebiet gegründet. Die Bekanntgabe der Beteiligung des RVR erfolgte als schlichte Pressemitteilung am 26. März 2025 unter der wenig spektakulären Überschrift „Schulministerium, Regionalverband Ruhr und Stiftung Mercator engagieren sich weiter für mehr Bildungsgerechtigkeit im Ruhrgebiet!“. Im Bildungsportal des Schulministeriums fand die Mitteilung keine Erwähnung. Wenig verwunderlich, dass ein größeres Medienecho ausblieb.
Bedeutsame Entscheidung
Laut RVR-Gesetz ist der Verband „eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung durch seine Organe. Er ist ein Gemeindeverband und dient dem Gemeinwohl der Metropole Ruhr“. Er ist zuständig für die staatliche Regionalplanung und -entwicklung im Verbandsgebiet, dem elf kreisfreie Städte und vier Kreise mit rund 5,1 Millionen Menschen angehören. Zu seinen ältesten gesetzlichen Kernaufgaben zählt er Schutz und Pflege der Umwelt durch Sicherung von Freiflächen. Bildung gehört nicht zu seinen Pflichtaufgaben.
Der Einstieg in das Bildungsunternehmen markiert einen wahrlich bemerkenswerten Positionswandel in der Verbandsgeschichte. Der Verband hatte lange Zeit darauf beharrt, wegen des fehlenden gesetzlichen Auftrags keinerlei Zuständigkeit für den Bildungsbereich zu haben. Auch nach der 2015 vorgenommenen Novellierung des RVR-Gesetzes, das die Übernahme freiwilliger Aufgaben im Auftrag der Mitgliedskommunen ausdrücklich ermöglicht, war von einer neuen Ära in der regionalen Bildungsplanung zunächst wenig zu spüren.
Politische Querelen
Ein Grund für die unspektakuläre, fast beiläufig wirkende Bekanntmachung liegt möglicherweise darin, dass die Freude über die mehrheitliche Zustimmung der Verbandsversammlung zum Erwerb der Mehrheitsanteile an RuhrFutur (Drucksache Nr.: 14/1780-1) durch den Ergänzungsantrag von CDU und SPD (Drucksache Nr.: 14/1879) getrübt wurde.
Der Antrag geht davon aus, dass nach 2029 mit dem Ausstieg von Mercator aus dem Unternehmen die Fortsetzung von RuhrFutur in der alleinigen Verantwortung des RVR wegen ungesicherter Finanzierung fraglich ist und daher auch der Beschluss zur vollständigen Übernahme unter einen Finanzierungsvorbehalt gestellt werden muss.
Auch die in der Pressemitteilung als „flankierende Maßnahme“ bezeichnete Unterstützung des Landes beim Erwerb der Mehrheitsanteile ist das Ergebnis eines komplizierten und zäh verhandelten politischen Deals. Am Ende wurde entschieden, dass RuhrFutur mit der besonderen Unterstützung der Startchancen-Schulen im Ruhrgebiet beauftragt und im Gegenzug aus dem Startchancen-Programm vom Land finanziell entschädigt wird.
Blick zurück
Die Stiftung Mercator gründete 2013 die gemeinnützige Gesellschaft RuhrFutur. Anlass war der von der Stiftung finanzierte und dem RVR herausgegebene Bildungsbericht Ruhr 2012 , der die extreme soziale und sozialräumliche Ungleichheit in der Verteilung frühkindlicher und schulischer Bildungschancen in den Kommunen des Ruhrgebiets belegen konnte.
Die Stiftung scharte einige kreisfreie Ruhrgebietsstädte als Partner von RuhrFutur um sich, die an der gleichnamigen Bildungsinitiative mitwirken wollten und sicherlich auch die Vorteile der finanziellen Unterstützung durch die Stiftung im Auge hatten. Im gemeinsamen Wirken und engem Austausch verpflichteten sie sich dem Ziel, das Bildungssystem leistungsfähiger und chancengerechter zu gestalten. Der RVR mit der Mehrzahl der kreisfreien Städte und Kreise schloss sich zunächst nicht an.
RVR als Partner der Bildungsinitiative RuhrFutur
Erst 2016 schlossen RVR und RuhrFutur einen Kooperationsvertrag. Mit der Unterzeichnung verpflichtete sich auch der RVR auf die gemeinsame Agenda zur Kooperation, zur Förderung bestehender Netzwerke und zur Verbreitung und Weiterentwicklung regionaler Lösungsansätze im Bildungsbereich. Inzwischen gehören bis auf den Kreis Wesel alle Verbandsmitglieder, sieben Hochschulen, das Land, die Stiftung Mercator und der RVR der Bildungsinitiative RuhrFutur an.
Als Teil der Bildungsinitiative leistet der RVR mit der regelmäßigen Durchführung von Bildungsforen einen zentralen Beitrag zu regionaler Kooperation und Kollaboration. Als verantwortlicher Herausgeber der Reihe „Bildungsimpulse Ruhr“ wirft er „Schlaglichter auf wichtige Themen in der Bildungsregion Ruhr“. Das letzte Heft in der Reihe ist dem Thema „armutssensibles und präventives Handeln – eine Aufgabe für Schulen und Kommunen“ gewidmet und gibt einen Einblick in Vorträge der gleichnamigen Veranstaltung.
Bilanzierung der Bildungsinitiative
Die vordringliche Aufgabe des RVR in seiner neuen Position als Besitzer der Mehrheitsanteile muss es sein, eine nüchterne Bilanz der gemeinsam mit RuhrFutur unternommenen Bildungsinitiative zu ziehen.
Unbestritten ist das große Verdienst von RVR und RuhrFutur: die Herausgabe der regionalen Bildungsberichte Ruhr von 2020 und 2024. Sie haben die massiven Probleme und Herausforderungen in allen Sektoren des Bildungsbereichs datenbasiert sichtbar gemacht, in den Kontext gesellschaftlicher Rahmenbedingungen eingeordnet und Vergleiche zu anderen Regionen ermöglicht.
Sie schärfen das bildungspolitische Bewusstsein, den Fokus auf die Besonderheit des Ruhrgebiets mit seiner sozialräumlichen Konzentration und Verfestigung von Armut und Armutsfolgen auszurichten, sie fördern die Kooperation der Kommunen und stärken die Entschlossenheit des Verbands, von Land und Bund stärkere Unterstützung als Hilfe zur Selbsthilfe einzufordern.
Der Schuldenstand, die hohen Ausgaben für Sozialleistungen und die vergleichsweise geringen Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen im Ruhrgebiet schränken ihre finanziellen Möglichkeiten erheblich ein, als Träger der Schulen und der Kinder- und Jugendhilfe auf die sozialen Risikolagen entlang der Bildungskette adäquat einzugehen. Gefordert und eindringlich angemahnt wird im Bildungsbericht Ruhr 2024 „eine politische Wende weg vom Gießkannenprinzip hin zu einer bedarfsorientierten Förderung“.
Strukturelle Barrieren
Aber trotz gemeinsamer Anstrengungen ist das Ziel der Bildungsinitiative, „das Bildungssystem leistungsfähiger und chancengerechter zu gestalten und allen Kindern und Jugendlichen faire Chancen auf Bildungszugang, -teilhabe und -erfolg zu eröffnen – unabhängig von ihrer Herkunft“ – nicht erreicht.
Konterkariert werden die Bemühungen um mehr Bildungsgerechtigkeit und Leistungsfähigkeit auch durch das mehrgliedrige Bildungssystem selbst, wie wissenschaftliche Studien längst nachgewiesen haben. Die im internationalen Vergleich viel zu frühe Aufteilung der Kinder auf unterschiedlich anspruchsvolle Schulformen ist nicht leistungsförderlich, sondern fördert die besonders enge Kopplung von familiärer Herkunft und Bildungserfolg und die Trennung der Kinder nach sozioökonomischen Kriterien. Daneben unterhält das Bildungssystem ein segregiertes Förderschulsystem, das die menschenrechtlichen Verpflichtungen der UN-Behindertenrechtskonvention massiv verletzt.
Wie die Schulverläufe und Schulabschlüsse evident belegen, fördert die „Schulvielfalt“ die strukturelle Benachteiligung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, von denen überproportional viele im Ruhrgebiet leben. Die Schulstrukturen gefährden den individuellen Bildungserwerb, den sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung der Region.
Statt die Übergänge nach der Grundschule in Frage zu stellen, engagiert sich die Bildungsinitiative RuhrFutur für ein Übergangsmanagement, das den Problemen der Selektion durch eine verbesserte Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure mit dem Projekt „Schulen im Team“ zu begegnen versucht.
Schulen ohne Übergang
Will der RVR seiner neuen Verantwortung für Bildung im Ruhrgebiet gerecht werden, muss er auch die schulstrukturelle Problematik auf seine Agenda setzen und Einfluss auf die Bildungspolitik der Landesregierung nehmen.
Im Interesse der Schulträger im Ruhrgebiet muss das Schulministerium den Weg für die Gründung und Förderung inklusiver PRIMUS-Schulen freimachen. Sie haben sich mit durchgängigem Lernen ohne selektive Übergänge nach der Grundschule im wissenschaftlich begleiteten Schulversuch bewährt. Sie ermöglichen allen Kindern – unabhängig von ihrem familiären Hintergrund, einer Behinderung oder einem anderen individuellen Merkmal – gleiche Chancen für ihre Potenzialentfaltung.
Insbesondere in stark segregierten städtischen Räumen können sie als Stadtteilschulen wirksam werden und an die Arbeit der Familiengrundschulzentren anknüpfen. Sie stellen als integrierte Schulen eine starke Ergänzung zu den integrierten Gesamtschulen in NRW dar.
Zukünftige Rolle von RuhrFutur
Zur organisatorischen und politischen Stärkung des Ruhrgebiets als Bildungsregion Ruhr ist es naheliegend, die Arbeit der einzelnen kommunalen Bildungsbüros im Ruhrgebiet zu koordinieren, gemeinsame Interessen der Mitgliedskommunen zu bündeln, Synergieeffekte zu schaffen und für die Erledigung gemeinsamer Aufgaben und Planungen zu nutzen.
Nach Auffassung der Grünen Fraktion im Ruhrparlament – der Verbandsversammlung des RVR – sollte der RVR diese Aufgabe RuhrFutur übertragen. In ihrem Programm zur Wahl des Ruhrparlaments heißt es dazu: „Wir wollen die strukturelle Vernetzung der Bildungseinrichtungen und die Koordination der kommunalen Bildungsbüros und-netzwerke befördern und im Zusammenspiel zwischen Kommunen und RuhrFutur gGmbH diese perspektivisch zur regionalen Bildungsagentur weiterentwickeln.“
Das Ruhrgebiet als BNE-Modellregion
Neben den vielen Problemen im Bildungsbereich gibt es auch einen Schatz, den es zu heben gilt. „Mit über 10 000 Organisationen bietet der außerschulische Bereich ein reiches und wichtiges Potenzial zur Bewältigung der Bildungsaufgaben der Region“, so der Bildungsbericht Ruhr 2024. Er hat erstmals die regionale Situation der außerschulischen Bildung mit ihren Strukturen und thematischen Schwerpunkten untersucht und vorgestellt.
Etliche Einrichtungen haben sich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) explizit auf die Fahnen geschrieben oder haben eine inhaltliche Nähe zu BNE entwickelt. Sie könnten als Partner der Schulen diese nicht nur personell verstärken, sondern sie auch als Lernort für BNE qualitativ weiterentwickeln im Sinne der Agenda 2030, zu deren Umsetzung sich die Bundesregierung, die KMK und die Kommunen verpflichtet haben.
Die transformatorische Vision, die Bildungslandschaft des Ruhrgebiets zur BNE-Modellregion zu entwickeln, sollte ein solider Baustein in dem ehrgeizigen Projekt des RVR werden, das Ruhrgebiet zur „grünsten Industrieregion der Welt“ zu machen. Die Umsetzung verlangt einen längeren Atem und ein zuverlässiges und nachhaltiges Engagement des RVR. Sie könnte konkret mit der Beauftragung von RuhrFutur beginnen, gemeinsam mit den kommunalen Bildungsbüros eine Konzeption zu entwickeln.
Dr. Brigitte Schumann 05/2025