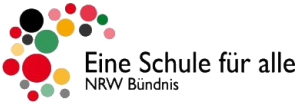Schulministerin Dorothee Feller hat sowohl den Landtag als auch die Öffentlichkeit nicht umfassend über den PRIMUS-Schulversuch informiert. In ihrem Bericht an den Schulausschuss ließ sie wesentliche Inhalte aus.
Schulministerin Dorothee Feller hat sowohl den Landtag als auch die Öffentlichkeit nicht umfassend über den PRIMUS-Schulversuch informiert. In ihrem Bericht an den Schulausschuss ließ sie wesentliche Inhalte aus.
Statt des Abschlussberichtes, den die Wissenschaftliche Begleitforschung dem Schulministerium bereits im November 2024 übergeben hatte, brachte die Schulministerin am 11. Dezember 2024 ihren eigenen Bericht über den PRIMUS-Schulversuch im Schulausschuss ein. Nach ihren eigenen Aussagen sei sie damit ihrer Berichtspflicht gegenüber dem Landtag nachgekommen. Erst aufgrund öffentlicher Kritik und auf Anforderung der SPD-Fraktion legte sie dem Ausschuss den zurückgehaltenen wissenschaftlichen Bericht zur Sitzung am 22. Januar 2025 vor. Im Gegensatz zu Feller hatte ihre Vorgängerin Yvonne Gebauer die wissenschaftlichen Berichte über die erste und zweite Phase des Schulversuchs direkt veröffentlicht und nicht durch eigene Berichte ersetzt.
Was zu kurz kommt
Der Vergleich zwischen beiden Berichten zeigt, dass es in der Zusammenfassung des Ministeriums bedeutsame inhaltliche Lücken und verschwiegene Stellen gibt.
Die Darstellung der quantitativen Ergebnisse zu den Abschlüssen und Lernstandserhebungen fällt auch im ministeriellen Bericht positiv aus. Es fehlt jedoch die Bewertung der Wissenschaft, dass sich ein potenzieller Begründungszusammenhang zwischen der Leistungsbilanz der PRIMUS-Schulen und dem Reformmodell ergibt – „ohne dass vereinfacht in Kausalitäten gedacht würde“. Dass die PRIMUS-Schulen gerade in segregierten Lagen mit guten Leistungen ihrer nicht privilegierten Schüler:innen glänzen können, wird in dem Abschlussbericht sehr viel nachdrücklicher dargestellt und hervorgehoben.
Die qualitativen Ergebnisse, die der Schulversuch hervorgebracht hat, kommen im Bericht des Ministeriums insgesamt zu kurz. Verfälscht wird meiner Ansicht nach auch die Tonalität der Wissenschaftler:innen. Die Ergebnisse des Berichts sind in dem Bemühen der Wissenschaftler:innen entstanden, nicht über die Schüler:innen zu schreiben – sondern sie aus der Interaktion mit den Forschenden zu Wort kommen zu lassen. Dieser Ansatz orientiert sich an den Kinderrechten und methodologisch an der Kindheitsforschung.
Die Wissenschaftler:innen zeigen, dass die Erfahrung von Gemeinschaftlichkeit in kontinuierlichen sozialen Beziehungen den Schüler:innen hochbedeutsam ist: für die individuelle Lernentwicklung, für die Fähigkeit, Verantwortung für die Peers zu übernehmen – und für die Zukunftsgewissheit, mit der sie die Schule verlassen.
Verschwiegenes bildungspolitisches Resümee
Die Wissenschaftler:innen legen in ihrem Resümee ein Bekenntnis zur PRIMUS-Schule ab: Sie sind überzeugt, dass es eine „gute Idee“ war, auf den institutionellen Übergang nach Klasse 4 zu verzichten und den Lernraum pädagogisch so auszugestalten, dass Leistungsfähigkeit und Gemeinschaftlichkeit sich gegenseitig bedingen.
Perspektivisch erklären sie: „Die Erfahrungen der Schüler:innen legen es um ein weiteres nahe, die feste Trennung nach der vierten Klasse grundsätzlich in Frage zu stellen. (…) Als wissenschaftliche Begleitung können wir mit den Schüler:innen zeigen, wie die Verbindung zwischen äußerer Strukturreform und innerer Schulreform zu der Erfahrung von Bildungserfolg beiträgt, die nicht auf der Idee des Gegeneinanders, sondern auf der Praxis eines Miteinanders basiert.“
Bildungspolitische Verweigerung gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen
An dem Verschweigen des Resümees im Bericht der Ministerin zeigt sich eine hartnäckige Verweigerung konservativer Bildungspolitik, sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen – vor allem wenn sie dem eigenen Weltbild nicht entsprechen. Die Vorstellung von der leistungs- und begabungsgerechten Aufteilung der Schüler:innen in möglichst homogene Lerngruppen als Voraussetzung für gute schulische Leistungen will die Ministerin nicht in Frage stellen.
Die politische Absage an eine tiefgreifende äußere Strukturreform verengt den öffentlich-politischen Diskurs über Schule und behindert demokratische Schulentwicklung. Wenn dies in Verbindung mit Vertuschung geschieht, wie im Falle des Ministeriumsberichtes, ist das demokratieschädlich.
Mit Vorsatz in Unwissenheit gelassen?
Im September 2024 leitete das Ministerium die Anhörung zum 17. Schulrechtsänderungsgesetz ein, in dem lediglich die Bestandssicherung der PRIMUS-Schulen vorgesehen ist. Zu diesem Zeitpunkt kannten selbst die kommunalen Spitzenverbände den Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung nicht. Das Ministerium dagegen hatte sich von den Wissenschaftler:innen vorab ein Update zum Schulversuch geben lassen.
Es ist offensichtlich, dass sich das Ministerium mit der Terminierung des Gesetzesvorhabens und der Anhörung unliebsame bildungspolitische Diskussionen über die Zukunft der PRIMUS-Schule ersparen wollte.
Wertvolle kommunale und regionale Handlungsperspektiven
Im Bildungsbericht Ruhr 2024 ist der Anteil der Dritt- und Achtklässler:innen, die in den Lernstandserhebungen nicht über die Mindestanforderungen in Deutsch und Mathematik verfügen, im Ruhrgebiet deutlich größer als in anderen Regionen des Landes. Insgesamt resümiert der Bildungsbericht, dass „die Vermittlung von Basiskompetenzen an Schulen in benachteiligten Lagen deutlich schlechter als an Schulen in bessergestellten Gebieten gelingt“.
Der Abschlussbericht auf der anderen Seite stellt heraus, dass PRIMUS-Schulen auch in Gebieten mit Tendenz zur Segregation in Lernstandserhebungen überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielen. Die Wissenschaftler:innen fassen zusammen: „Mit dem Blick auf die sozialen Standortbedingungen stellen die PRIMUS-Schulen einen Raum für die Ermöglichung erfolgreicher Bildungsverläufe dar. Sie tragen damit zur Bildungsgerechtigkeit bei und ermöglichen den Bildungserfolg der Schüler:innen.“
Für mich ist klar: Diese Befunde, die den kommunalen Schulträgern Handlungsperspektiven eröffnen, dürfen nicht verschwiegen, sondern müssen zugänglich gemacht werden. Kommunen müssen die Möglichkeit bekommen, PRIMUS-Schulen zu errichten. Der Landtag muss das 17. Schulrechtsänderungsgesetz, das noch nicht verabschiedet ist, im Hinblick auf die Zukunft der PRIMUS-Schule in NRW neu bewerten!
Dr. Brigitte Schumann 01/2025